Die Anzahl Staatsangestellten ist in der Schweiz unglaublich hoch. Die Stadt Zürich beschäftigt mittlerweile ein Heer von 30'000 Angestellten, in Winterthur sind es immerhin 5’500. Auch beim Bund werden laufend neue Stellen geschaffen werden – und zwar in allen Departementen. Diese Tendenz kann der Schweizer Wirtschaft nachhaltig schaden.
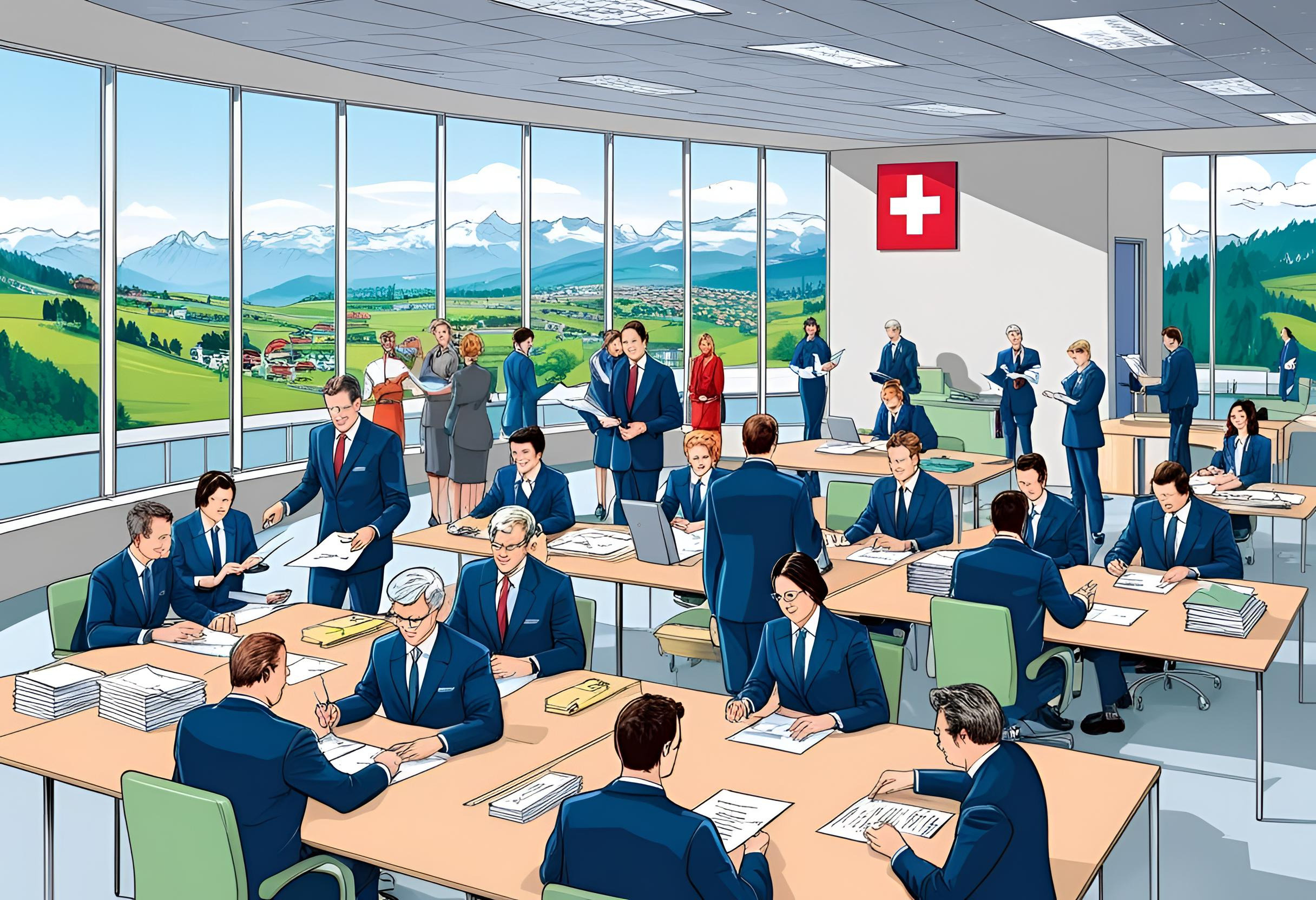
Bildquelle: KI-generiert mit Canva
Die Verwaltung in Schweizer Städten wächst rasant – in manchen Fällen sogar schneller als die Bevölkerung. Besonders deutlich wird dies in Zürich, wo mittlerweile rund 30'000 Menschen in der Stadtverwaltung arbeiten. Eine Studie des Think-Tanks Avenir Suisse zeigt, dass Zürich im Vergleich zu anderen Schweizer Städten die grösste Verwaltung besitzt. Während die Bevölkerung in den letzten elf Jahren um 14 % gewachsen ist, stieg die Zahl der Verwaltungsangestellten um 21 %. Im Vergleich dazu konnte Winterthur mit demselben Bevölkerungswachstum seine Verwaltung lediglich um 4 % ausbauen (NZZ, 2025). Trotzdem weist Winterthur von allen Grossstädten die zweithöchste Anzahl Angestellter relativ zur Bevölkerung auf – 2023 waren es knapp 5500 Personen (Stadt Winterthur 2024). Obwohl die von den Städten veröffentlichten Zahlen diejenigen von Avenir Suisse jeweils deutlich übersteigen, bleibt die Tendenz gleich.
Die Situation in Winterthur ist besonders problematisch, da die Stadt nicht über die gleichen finanziellen Ressourcen wie Zürich verfügt. Trotz steigender Anforderungen in Bereichen wie Bildung und Infrastruktur bleibt der finanzielle Spielraum eng, da die Steuereinnahmen nicht signifikant wachsen. Ein Ausbau der Verwaltung ist daher kaum vertretbar, was die Stadt zu strenger Effizienz zwingt. Kritiker bemängeln jedoch, dass Doppelspurigkeit und Ineffizienzen weiterhin bestehen und der Druck auf die bestehenden Verwaltungsmitarbeitenden steigt. Die Herausforderung besteht darin, notwendige Dienstleistungen bereitzustellen, ohne die finanziellen Grenzen der Stadt zu sprengen.
Drei Hauptfaktoren tragen zum überdurchschnittlichen Verwaltungswachstum in Zürich bei: Zentrumslasten, zunehmende administrative Komplexität und eine linke politische Ausrichtung, die mehr staatliche Leistungen fordert. Zürich kann sich diesen Ausbau aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke leisten, während Winterthur gezwungen ist, sparsamer zu wirtschaften. Die Unterschiede zwischen den beiden Städten zeigen, dass nicht nur das Wachstum der Verwaltung, sondern auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen über deren Tragbarkeit entscheiden (NZZ, 2025).
Das Problem betrifft jedoch nicht nur die Städte. Auch auf Bundesebene werden kontinuierlich neue Stellen geschaffen – unabhängig von der Parteizugehörigkeit der jeweiligen Vorsteherinnen und Vorsteher. Dies treibt nicht nur die Lohnkosten in die Höhe, sondern führt auch zu einer wachsenden Konkurrenz mit der Privatwirtschaft um Fachkräfte. Angesichts eines ohnehin angespannten Arbeitsmarktes verstärkt die rasche Einstellung von Staatsangestellten den Druck auf die Zuwanderung (economiesuisse, 2025).
Internationale Vergleiche zeigen unterschiedliche Entwicklungen. Während viele Länder ihre Verwaltungen ebenfalls ausbauen, verfolgen die USA eine radikale "Beamtenbremse". Auch in der Schweiz stellt sich die Frage, ob eine Begrenzung des Verwaltungswachstums notwendig ist. Es geht dabei jedoch weniger um eine pauschale Reduktion der Verwaltung als vielmehr um eine Begrenzung der politischen Expansion. Denn neue staatliche Aufgaben führen automatisch zu einem grösseren Personalbedarf. Statt einer "Beamtenbremse" wäre daher eine "Politikbremse" erforderlich, um den Expansionsdrang von Exekutive und Legislative einzudämmen (economiesuisse, 2025).
Langfristig bedarf es einer umfassenden Überprüfung aller staatlichen Aufgaben: Welche sind wirklich notwendig, welche haben Priorität? Gleichzeitig könnten verstärkte Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz dazu beitragen, Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten. Ziel sollte ein leistungsfähiger, aber schlanker Staat sein. Ein ungebremstes Wachstum des öffentlichen Sektors belastet nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den Arbeitsmarkt. Auch Winterthur steht daher vor der schwierigen Aufgabe, ein Gleichgewicht zwischen notwendiger Verwaltung und finanzieller Nachhaltigkeit zu finden. Ohne klare politische Massnahmen droht ein weiteres Wachstum der Verwaltung – welches der Privatwirtschaft enorm schaden könnte.
Andrin Gross, Bachelor of Arts in Politikwissenschaften, Werkstudent HAW







