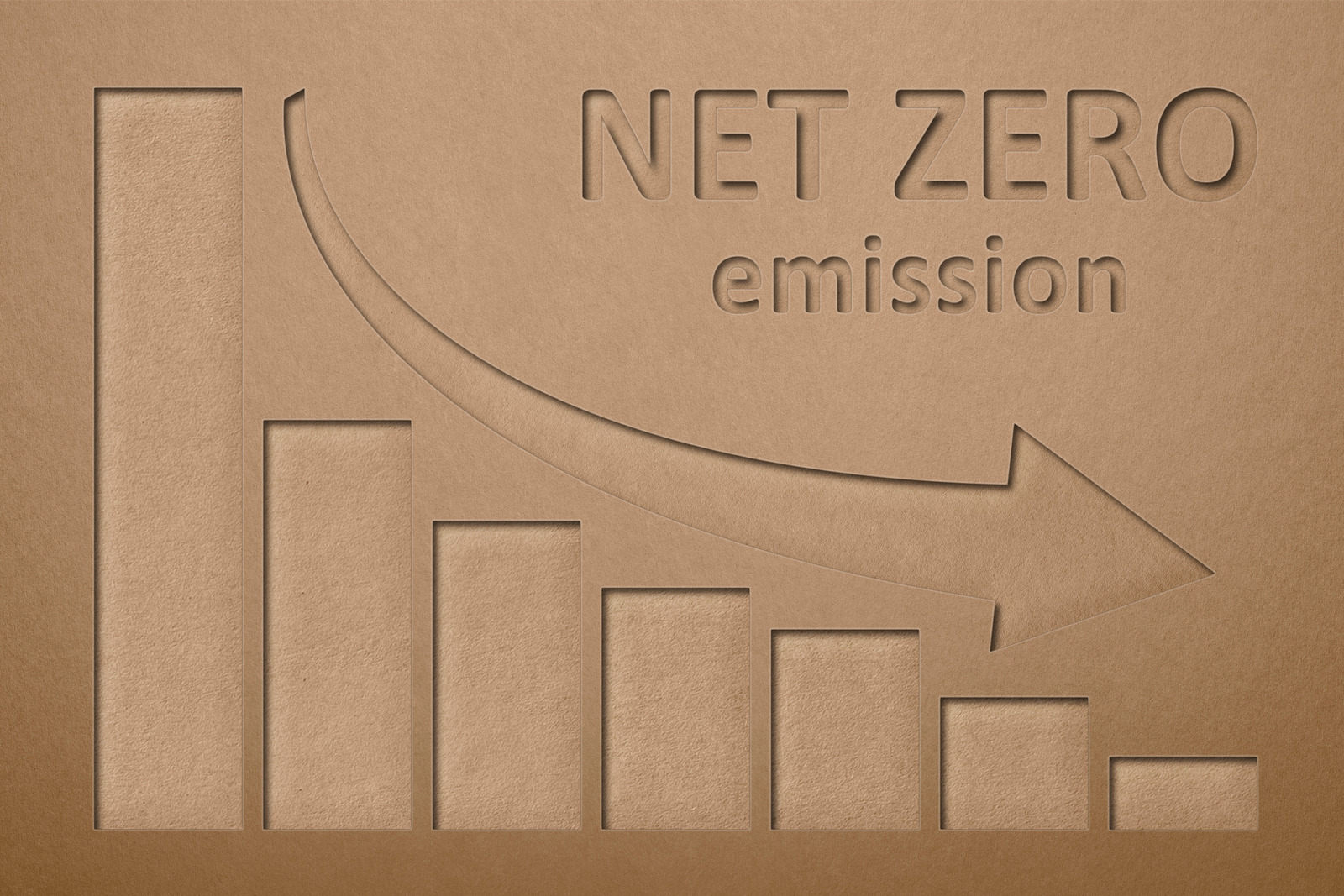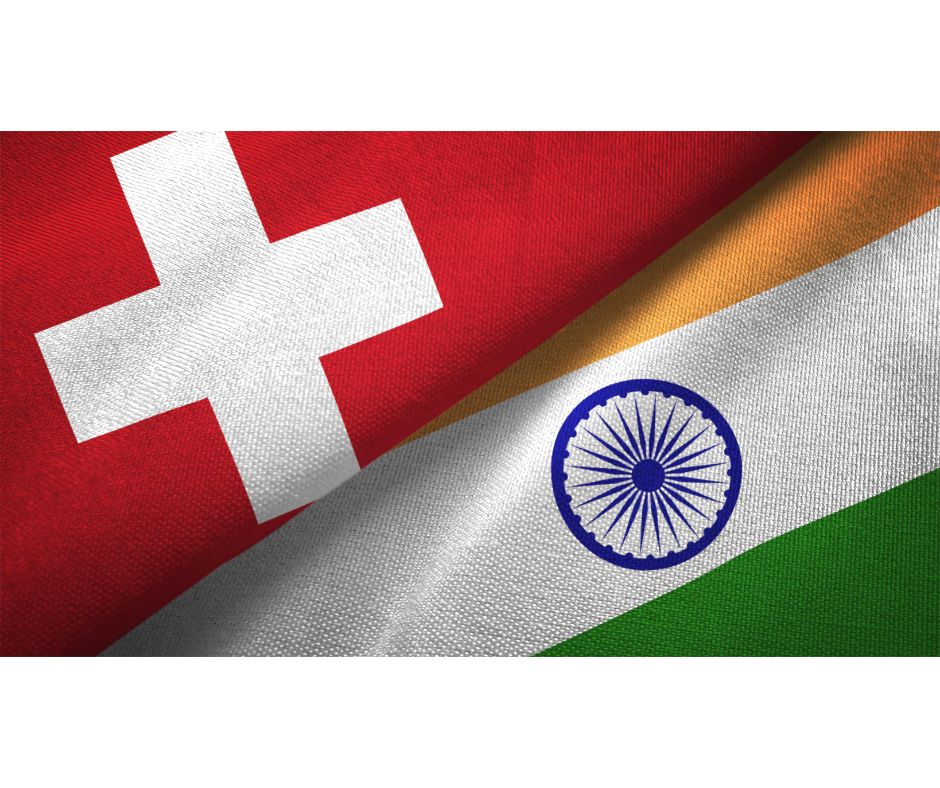Eine besondere Stärke der akademischen Programme der ZHAW School of Management and Law (SML) ist die Möglichkeit für die Studierenden, eng mit Unternehmen und Organisationen zusammenzuarbeiten. Die Unterstützung von Unternehmen bei ihren internationalen Aktivitäten und die Förderung von Studierenden beim Erwerb von internationalen Geschäfts- und interkulturellen Kompetenzen sind zwei wichtige Ziele des Departements International Business und des International Management Institute.
2x Nein zu den Gesundheitsinitiativen
Von economiesuisse am 12.04.24 17:12
Das Schweizer Gesundheitssystem kränkelt. Man liest und hört dies aktuell überall und merkt es auch im eigenen Portemonnaie. Es muss gestärkt und kostengünstiger werden. Doch wie in der Medizin muss die Behandlung gezielt erfolgen, um ungewollte gefährliche Risiken und Nebenwirkungen zu minimieren. Die beiden Gesundheitsinitiativen sind aber klassische Behandlungsfehler. Sie lösen keine Probleme, sondern schaffen neue und sind deshalb abzulehnen. Bei einem Nein treten die zielgerichteten Gegenvorschläge in Kraft.
Schlüsseltechnologien für die Smart Factory
Von Ralph Peterli am 12.04.24 11:04
Die HAW veranstaltete einen weiteren Smart Machines-Experten-Anlass und genoss dabei Gastrecht bei ihrem Mitglied Noser Engineering. Hausherr Remo Noser formulierte in seiner Begrüssung der 25 SpezialistInnen die Ambition seiner Firma, aus Daten Werte zu schaffen, um unsere Wirtschaft erfolgreich zu machen und weiterhin die weltbesten Maschinen zu bauen. Thema des Abends waren in der Folge Schlüsseltechnologien und entscheidende Fähigkeiten für die Smart Factory. Die angeregte Diskussion belegte eindrücklich, den Wert des Austausches von Experten verschiedener Unternehmen und Branchen.
Prämien-Entlastungs-Initiative Teil 1: Wie Prämienverbilligungen funktionieren
Von HAW Redaktion am 11.04.24 16:19
Krankenkassenprämien werden in nächster Zeit das grosse innenpolitische Thema in der Schweiz sein. Am 9. Juni stimmt das Schweizer Volk gleich über zwei Vorlagen ab, welche auf eine Verbilligung der Prämien abzielen. Eine grosse Bedeutung hat dabei vor allem die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP, welche verlangt, dass die Prämien nicht mehr als 10 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens ausmachen dürfen.
Bei nachhaltigen Kaufentscheidungen ist der Kontext entscheidend
Von ZHAW am 11.04.24 09:09
Vermehrt kauft die Schweizer Bevölkerung gebrauchte Kleidung und elektronische Geräte. Dennoch scheitern nachhaltige Alternativen häufig am Preis, dem Wissensstand oder der fehlenden Transparenz. Beim Kauf von Lebensmitteln fällt es gemäss einer ZHAW-Studie leichter nachhaltiges Verhalten zu erkennen als bei Textilien oder Unterhaltungselektronik.
13. AHV: Finanzierung mittels Mehrwertsteuer- und Rentenaltererhöhung
Von SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband am 08.04.24 15:18
Nach der Annahme durch das Volk schlägt der Bundesrat zwei Varianten zur Finanzierung vor: eine Finanzierung mittels Lohnprozenten sowie eine Mischfinanzierung mittels Lohnprozenten und zusätzlichen Mehrwertsteuerprozenten. Die Arbeitgeber würden eine ausschliessliche Finanzierung durch höhere Mehrwertsteuern bevorzugen. Es wäre die Lösung, welche Wirtschaft und Mittelstand am wenigsten belastet, die Finanzierung fair über die Bevölkerung verteilt und unsere Sozialwerke langfristig am stabilsten hält. Dass diese Variante nun gar nicht vorgeschlagen wird, erstaunt.
Wirtschaftswoche in der Kantonsschule im Lee
Von Simon Bründler am 25.03.24 15:04
Auch dieses Jahr hat die HAW die Wirtschaftswoche am Winterthurer Gymnasium Im Lee mit Erfolg durchgeführt. Nach dem Konzept der wirtschaftsbildung.ch und mit Unterstützung von Spielleiterinnen und Spielleiter - Führungskräften aus der Privatwirtschaft - wurden rund 150 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in die Grundlagen der Wirtschaft eingeführt. Verschiedene Unternehmen aus Winterthur und Umgebung gewährten zudem an einem Nachmittag Einblick in die Praxis und stellten sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler.
Das neue CO2-Gesetz ist wirksam und vernünftig
Von economiesuisse am 20.03.24 11:07
Nach dem Nein der Bevölkerung im Sommer 2021, hat das Parlament der Neuauflage des CO2-Gesetzes in dieser Session zugestimmt. Es ist ihm gelungen, eine ausgeglichene Vorlage zu verabschieden. Das neue Gesetz zeigt, wie mehrheitsfähige und wirksame Klimapolitik auch ohne Symbolpolitik und unrealistische Forderungen geht. Das erfolgreiche Instrument der Zielvereinbarungen mit Verminderungsverpflichtungen steht mit dem neuen Gesetz endlich grundsätzlich allen Unternehmen zur Verfügung. Die Stärken des neuen Gesetzes sind, dass keine neuen Abgaben wie die Flugticketabgabe und auch keine Erhöhung der CO2-Abgabe geplant sind.
Bildquelle: Canva HAW/Forum
Wie soll die 13. AHV-Rente finanziert werden?
Von HAW Redaktion am 14.03.24 16:30
Am 3. März 2024 haben die StimmbürgerInnen die 13. AHV-Rente klar angenommen. Noch immer ist allerdings unklar, wie diese finanziert werden soll. Es stehen diverse Vorschläge von Akteuren aller politischen Couleur im Raum: Das Spektrum reicht von Erhöhungen allgemeiner und spezifischer Steuern zu Beiträgen über Einsparungen in anderen Bereichen bis zu sozialpolitischen Veränderungen. Nur wenige Massnahmen scheinen auch realistisch. Wesentlich ist, dass je nach Vorschlag ganze Bevölkerungsgruppen benachteiligt werden und dass – mit einer Ausnahme – das Grundproblem nicht an der Wurzel angegangen wird.
Bildquelle: Canva HAW/Forum
Meilenstein für die Exportnation Schweiz: EFTA-Freihandelsabkommen mit Indien unterzeichnet
Von economiesuisse am 11.03.24 07:43
Die Verhandlungen über das EFTA-Freihandelsabkommen mit Indien konnten nach 16 Jahren erfolgreich abgeschlossen werden. Das Abkommen wird die Schweizer Exporte in das aufstrebende Land markant vereinfachen. Für die Schweizer Exportwirtschaft bietet sich dadurch die Gelegenheit vom Wirtschaftswachstum Indiens zu profitieren.